Besuch der Sternsinger am Brunnen
ein wunderschöner, gerader Baum, der gut bewacht ohne Schaden in den Mai gekommen ist.
100 Jahr Wassergenossenschaft: 24.Mai von 11:00 bis 16:00 Uhr Brunnenfest
07. September 2025 ab 11:30 am Dorfplatz
Liebe Schönenborner,
 zum 100-jährigen Jubiläum veranstaltet die Wasserversorgungs-Genossenschaft
am 24.05.2025 von 11:00 -16:00 Uhr im Ortskern von Schönenborn ein Brunnenfest.
Alle sind herzlich eingeladen, an diesem Jubiläumsfest teilzunehmen. Bei dem Brunnenfest hat die Dorfgemeinschaft ihre Unterstützung zugesagt (Montag, 12. Mai um 18:00 Uhr Treffen der Helfer am Brunnen). Wir werden den Verzehr organisieren und den Getränkeverkauf.
Darüber hinaus werden Biertische, Bierzeltgarnituren und Zelte aufgestellt. Das soll in Gemeinschaft mit der Wassergenossenschaft erfolgen.
zum 100-jährigen Jubiläum veranstaltet die Wasserversorgungs-Genossenschaft
am 24.05.2025 von 11:00 -16:00 Uhr im Ortskern von Schönenborn ein Brunnenfest.
Alle sind herzlich eingeladen, an diesem Jubiläumsfest teilzunehmen. Bei dem Brunnenfest hat die Dorfgemeinschaft ihre Unterstützung zugesagt (Montag, 12. Mai um 18:00 Uhr Treffen der Helfer am Brunnen). Wir werden den Verzehr organisieren und den Getränkeverkauf.
Darüber hinaus werden Biertische, Bierzeltgarnituren und Zelte aufgestellt. Das soll in Gemeinschaft mit der Wassergenossenschaft erfolgen.
Notiert Euch den Termin: Sonntag, 7. September 2025 ab 11:30 Uhr Was erwartet Euch??? Geselligkeit, Spaß und Unterhaltung mit Freunden, Familie und Nachbarn bei einem kühlen Kölsch vom Fass... oder lieber ein spritziges Mixgetränk ?? frisch gebrühter Kaffee in unserer Freiluft Cafeteria in uralten Sammeltassen serviert, dazu hausgebackene Kuchenauswahl die beliebten Matjes im Brötchen aus eigener Herstellung herzhafte Leckereien aus dem Steinofen Backhaus ein breitgefächertes Angebot für unsere Kinder und die eine oder andere Überraschung! Wir freuen uns sehr....und werden bei jedem Wetter den 7. September 2025 mit unseren Gästen genießen.
Liebe Schönenborner,
so eine tolle Maifeier hatten wir schon lange nicht mehr….herrlich warmes Wetter, jede
Menge Teilnehmer von Jung bis Alt, super Stimmung, ein reichhaltiges Büfett und wieder ein
wunderschöner, gerader Baum, der gut bewacht ohne Schaden in den Mai gekommen ist.
.
Weiter geht es wahrscheinlich auch dieses Jahr mit den Pfingstsängern. Wir werden den Termin noch rechtzeitig bekannt geben.
Herzliche Grüße
Gudrun
Liebe Schönenborner!
 Gemeinsame Zeit in gemütlicher Runde bei einer Original Bergischen Kaffeetafel zu erleben,
das war das Geburtstagsgeschenk 2024 für alle unsere lieben Senioren im Dorf. Mitte April
hat der Vorstand mit vereinten Kräften dieses Event wahr werden lassen. Es war ein ganz
toller Nachmittag mit allem Drum und Dran….frisch gebackenen Waffeln, Kirschen, Sahne,
Milchreis, verschiedene Brot- und Wurstsorten aus dem Fachgeschäft und zwischendurch ein
Gläschen Sekt oder ein Likörchen durften nicht fehlen. Serviert in alten Dröppelminas und
zum Teil noch älterem Service…alles stilvoll und „echt bergisch“
. Es waren alle da (bis auf
eine Person ) und auch auf Elisabeth haben wir einen Toast ausgebracht. Ein besonderer Dank
an Margot, die geplant und geholfen hat und Markus+Silke, dass wir wieder Hommerich
unsicher machen durften.
Gemeinsame Zeit in gemütlicher Runde bei einer Original Bergischen Kaffeetafel zu erleben,
das war das Geburtstagsgeschenk 2024 für alle unsere lieben Senioren im Dorf. Mitte April
hat der Vorstand mit vereinten Kräften dieses Event wahr werden lassen. Es war ein ganz
toller Nachmittag mit allem Drum und Dran….frisch gebackenen Waffeln, Kirschen, Sahne,
Milchreis, verschiedene Brot- und Wurstsorten aus dem Fachgeschäft und zwischendurch ein
Gläschen Sekt oder ein Likörchen durften nicht fehlen. Serviert in alten Dröppelminas und
zum Teil noch älterem Service…alles stilvoll und „echt bergisch“
. Es waren alle da (bis auf
eine Person ) und auch auf Elisabeth haben wir einen Toast ausgebracht. Ein besonderer Dank
an Margot, die geplant und geholfen hat und Markus+Silke, dass wir wieder Hommerich
unsicher machen durften.
Welch ein Zeichen von unserer jungen Generation, das ganze Dorf zur Party einzuladen!
Danke an Anja und Martha für die Einladung…dank moderner Smartwatch weiß ich, dass ich
um 3:11 Uhr in meinem Bett gelegen habe. Schön und lecker war es…
Wir leben Dorfgemeinschaft und ich persönlich wünsche mir, in einem Vierteljahrhundert
auch noch mit einer Aufmerksamkeit zu meinem 80ten Geburtstag in Schönenborn beschenkt
zu werden. Dafür bedarf es meiner Meinung die Motivation und den Mut, kleine und große
Dinge gemeinsam in Dorf anzugehen. Jeder nach seinen Möglichkeiten!
• April Dorfputz.
• 30.4.25 Maibaum setzen, ab 18:30 Uhr fährt der Trecker los zum Maibaum holen,
Fleisch/Wurst und Getränke zentraler Einkauf, Rückmeldung an Julian oder mich
erwünscht zwecks Planung, jeder bringt was für das Salat Büfett mit bitte , Gäste
willkommen, Spendenschwein wird aufgestellt
• Juni Dorfausflug,
• Ende Mai Pfingstsänger im Dorf ca. 18:50 Uhr, bitte bei mir melden, wer noch helfen
kann (Grillen, Bierzeltgarnituren etc.)
Herzliche Grüße
Dorfgem. Schönenborn e.V.
Gudrun Fußbroich
1. Vorsitzende
Danke, ihr seid tolle Gäste!
"Habt ihr auch eine Kasse?" "Klar haben wir eine Vereinskasse. Wie dürfen wir helfen?" "Es ist so schön bei euch auf dem Dorffest, dass möchte ich gerne mit einer Spende unterstützen, weil wir nächstes Jahr auf jeden Fall wiederkommen möchten."
Gibt es ein größeres Kompliment? Da lohnen sich die ganzen Vorbereitungen seit bereits Wochen im Voraus.
Was bieten wir an dieses Jahr? Welche Mengen? Haben wir alle Genehmigungen? Sollen wir die Zelte aufstellen? Fragen, die manchmal bis auf den letzten Drücker unbeantwortet bleiben müssen. Viele Abläufe sind mittlerweile Routine, das ist eine große Erleichterung.
Pünktlich zum Start mit der Hl. Messe um 11:30 Uhr lacht die Sonne vom Himmel und überall gibt es zufriedene Gesichter, unter anderem auch von Bürgermeister Herrn Dr. Georg Ludwig und seiner Frau Sabine. Viele junge Familien sind mit Ihren Kindern gekommen und genießen das große Unterhaltungsangebot. Hüpfburg, Ponyreiten, Kinderschminken sind nur eine kleine Auswahl. Sehr großen Andrang findet das Lichtgewehr Schießen der Schützenbruderschaft Schmitzhöhe, der ein oder andere Teilnehmer liebäugelt bereits mit einer Mitgliedschaft.
Martina Hartkopf, angehende Gemeindereferentin, hat die Hl. Messe unter dem Aspekt "Gemeinschaft" mitgestaltet. Ein Thema, dass in Schönenborn noch tatkräftig gelebt wird. Sonst wäre so ein Fest nicht zu stemmen.
Das reichhaltige Angebot an selbstgebackenen Torten lockt im Anschluss an die Hl. Messe, die wieder unterstützt wurde von den Young Voices unter Leitung von Kantor Martin Außem, viele Besucher zum Verweilen in der Freiluft Cafeteria. Dort ein aus den Sammeltassen frischgebrühten Kaffee zu genießen ist durchaus etwas ganz Besonderes. Ein Stück weiter unten duftet es verführerisch....das 2. Jahr in Folge wird Pizza aus dem eigenen Dorf Backes angeboten. Das Feuer lodert und die Mannschaft kommt gehörig ins Schwitzen, wenn der Ofen geöffnet wird. Eine andere Delikatesse sind die Matjes Brötchen. Die Filets werden vom Großmarkt in Köln geholt und dann von den "Fischdamen" weiterverarbeitet. Das bedeutet unter Tränen einen großen Sack Zwiebeln auf feine Ringe schneiden und anschließend mit frischem Dill einlegen. Nach Spielende kommen die Fußballer der SV Eintracht Hohkeppel vorbei und halten die Jungs von der Bierbude gehörig auf Trapp. Auch andere Vertreter der umliegenden Vereine und Ausschüsse tauschen sich als kleine offizielle Geste mit der Vorsitzenden der Dorfgemeinschaft aus. Das ist gelebte Unterstützung und Gemeinschaft.
DJ Hotte sorgt den ganzen Tag für Stimmung und mit Paulchen Panter wissen alle Gäste, dass wirklich Feierabend ist!
Toll, das ihr mit uns gefeiert habt.
Schönenborn sagt Danke.
Herzliche Grüße
Dorfgem. Schönenborn e.V.
Gudrun Fußbroich
1. Vorsitzende
Dorffest 2025:
Wir bereiten für unsere Gäste auch nächstes Jahr einen hoffentlich wunderbaren Sonntag im Herzen von Schönenborn vor.
Notiert Euch den Termin: Sonntag, 7. Septembr 2025
Was erwartet Euch???
Geselligkeit, Spaß und Unterhaltung mit Freunden, Familie und Nachbarn
Wir freuen uns sehr....und werden bei jedem Wetter den 7. September 2025 mit unseren Gästen genießen.
Rundgang durch Schönenborn
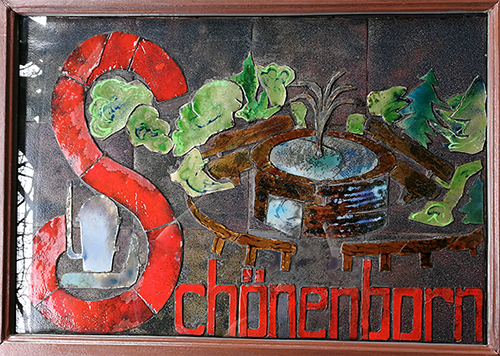






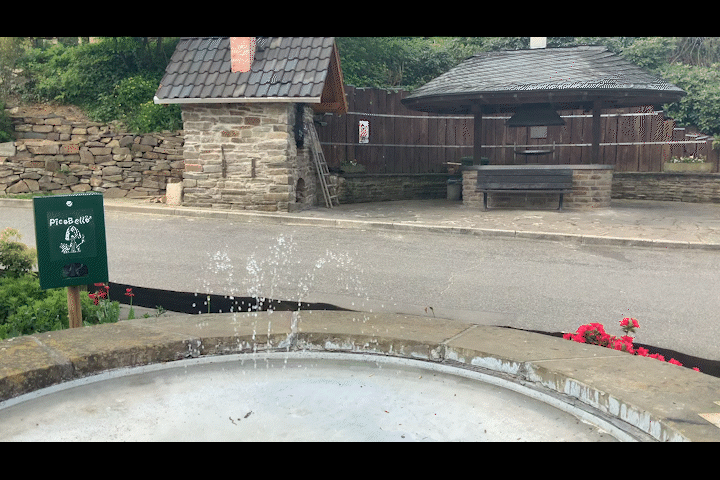




Laut Heimatbuch der Gemeinde Hohkeppel, das anläßlich der Tausendjahrfeier im Jahre 1958 erschienen ist, wird der Ort Schönenborn erstmalig im Jahre 1475 urkundlich erwähnt. In einem Register über Fuhrdienst, die für den Steinbacher Amtmann Wilhelm von Bellinghausen geleistet wurden, heißt es: "Item Heinrich van schoeneken (Schönenborn) gfoirt dry karren kollen (Holzkohlen) zu Collen van myne gnedig hern (des Herzogs) weygen in meyster Johannes huyß van Borche, davoir sind den do loin van yeder karre 1 rh(einischer) gld (Gulden)."
Das Lindlarer Heimatbuch von 1976 führt das Jahr 1478 als das Geburtsjahr von “schoynbyrn” in alten Urkunden an. Sei es nun, dass die Urkunde von 1475 im Lindlarer Heimatbuch nicht berücksichtigt wird, oder dass der Autor meint, unter “schoeneken” nicht unbedingt Schönenborn verstehen zu müssen, fest steht jedoch, dass Schönenborn inzwischen über ein halbes Jahrtausend alt ist.
1487 schließlich taucht Schönenborn erstmalig in der heutigen Schreibweise auf; in einer “Auftragung der Untersassen” des Herzogtums Berg ist vermerkt, dass “schönenborn” zu jener Zeit drei steuerpflichtige Einwohner hatte.
Der Name Schönenborn läßt sich wahrscheinlich ableiten von: schöner Brunnen oder Brunnen in den Schöenen (= Schollen).
Charakteristisch für das Bergische war die Benennung der Menschen mit ihrem Vornamen und dem Namen des Wohnsitzes. Familienname und Herkunftsort waren also in früheren Zeiten identisch. So dürfte auch die Stammfamilie in Schönenborn eben diesen Zunamen getragen haben. In einer Huldigungsliste aus dem Jahre 1666 werden dann auch drei Männer - Pitter, Gerhartt und Donneß (= Anton) - mit dem Zunamen Schonenborn bzw. Schonenbohrn erwähnt. Auch eine noch heute erhaltene Balkeninschrift am Haus Nr. 6 weist auf diese Stammfamilie hin, sie lautet: "ANNO 1686 HAT JORGEN ZV SCHONENBONEN VND JERTGEN SEIN HAVSFRAV DIS HAVS BAVEN LASSEN. + IHS STEN IN GOTTES HANT."
Berichte aus den Jahren 1739, 1763 und 1790 lassen sicher darauf schließen, dass auch heute noch drei Familien in Schönenborn leben, deren Vorfahren eine Tochter aus der Sippe der Schönenborn geheiratet haben.
Anhand alter Katasterauszüge läßt sich rekonstruieren, dass der gesamte Besitz der Schönenborner Familien in früheren Jahren einmal von der Lennefe, zwischen Köttingen und Lennefermühle, bis an die Sülz, zwischen Georgshausen und Welzen und von Bomerich (Gärtnerei Roth) bis zur Kapelle in Schmitzhöhe reichte. Dabei blieben nur das Gut “Flötbotz”, das Gut Luttersiefen und die zu Holl gehörenden Ländereien ausgespart. Die Schönenborner Ländereien dürften damit gut 300 Morgen umfaßt haben. Anfangs wurde erwähnt, dass schon 1475 ein Heinrich von Schönenborn drei Fuhren Holzkohle nach Breche lieferte. Laut eines Berichtes der Rundschau vom 26. März 1981, könnte dieses zu Burg Berger bei Altenberg liegen. Ob nun hier Holzkohle im gewerblichen Sinne hergestellt wurden, lässt sich mangels Unterlagen nicht beweisen. Doch beweisen die alten Köhlerplätze hier “Auf der Ente”, “Im Scheurenbusch”, “In der Schlad”, “Im Puhl”, “Im Kromsfeld” und auch im “Reichenhain”, dass hier früher Köhler tätig waren.
Kalksteinbrüche “Im Kleefelderbusch”, “In der Schlad”, wie auch im “Teufelsbusch” und auf der “Tittel” zeigen, dass hier früher auch Kalksteine gebrochen wurden. Diese wurden an Ort und Stelle in Öfen von 2 m Durchmesser gebrannt. Vier solcher Ofenstellen sind im “Kleefelderbusch” noch zu erkennen. Vor Jahren, bei der Errichtung des Sportplatzes um 1965, wurden noch drei Lagerplätze von Brennöfen eingeebnet.
Im Heimatbuch der Gemeinde Engelskirchen von 1951 steht auf Seite 16 oben: Freiherr von Quadt, Haus Alsbach, erhielt 1746 einen Mutungsschein auf Eisenerz auf dem “Schönenborner Felde” Kirchspiel Hohkeppel. Dieser wurde aber trotz zweimaliger Verlängerung nicht ausgenutzt. Laut Hohkeppeler Heimatbuch erwarb Karl Funk und Konsorte am 3.10.1799 das Mutungsrecht an der “Bergkaule” im Schönenborner Felde.
Am 2. Juli 1857 wurde eine Übereinkunft zwischen der Eisensteinzeche Marschall Vorwärts in Schönenborn mit dem Sitz in Werden an der Ruhr, und den Schönenborner Einwohnern abgeschlossen. Danach wurde festgelegt, wann jede Partei das Wasser des Holler Siefens benutzen durfte. Die Zeche Marschall Vorwärts konnte in der Zeit vom 1. Januar bis 15. April und vom 15. Mai bis 15. November sowie vom 15. bis 31. Dezember alljährlich das gesamte Wasservorkommen für sich beanspruchen. In der übrigen Zeit dagegen stand es den Schönenborner Bewohnern (Wiesenbesitzern) zur Verfügung. Auch verpflichtet sich die Grubenverwaltung, den Weg von dem Schacht bis zur Eisensteinwäsche in gutem Zustand zu halten. Als Repräsentant der Grubenverwaltung unterzeichnete ein Josef Wiegemann aus Weden an der Ruhr und für die Grundbesitzer; Elisabeth Hammerschmidt, Gerhard Wild, Wilhelm Eschbach, Roland Meeger, Johann Höller, Bernhard Breidenbach und Peter Breidenaßel.
Es sei noch vermerkt, dass Peter Breidenaßel am 30.11.1860 ein Abkommen mit der Grubenverwaltung schloß, wonach er sich verpflichtete, für 48 Reichstaler das Einebnen der Einsenkungen der Grube zu übernehmen. Laut Jahrbuch wurde auch in dieser Zeit der Grubenbetrieb eingestellt. In früherer Zeit, so berichteten ältere Jahrgänge, wäre in der Nähe der Schachtanlage, gegenüber dem “Holler Pettchen”, der Stollen einmal eingebrochen und eine Kuh wäre damals lebendig begraben worden. Der Weg zur Eisensteinwäsche war früher durchgehend bis Loxsteeg. Dadurch bestand auch die Möglichkeit, die Kalksteine aus den “Schladerkalksteinbrüchen” zu den oben erwähnten Kalksteinöfen im Kleefelderbusch zu transportieren.
Das Eisenerz wurde wahrscheinlich nach Welzen in die dortige Eisenschmelze gefahren, wo um 1782 Johann Gerhard Hamm aus Oberbergscheid Grundbesitz hierfür erworben hatte. Am 3. Mai 1783 übertrug dieser das Gelände an seinen Sohn Christian, welcher dort ein Hammerwerk errichtete. Einige hundert Meter ostwärts, Richtung Schmitzhöhe, befand sich zu der Zeit ebenfalls ein Eisenbergwerk. Der Eingang ist an der vorgelagerten Kieshalde im Vorfeld auch heute noch erkennbar, ebenso der Förderschacht mit etwa 30 bis 40 m Abstand östlich vorm Kutschweg. Der Stollen dürfte, wie auch der von Marschall Vorwärts, eine Länge von etwa 200 m gehabt haben. Interessante Berichte hierüber sind im Heimatbuch 1958 auf Seite 27-29 und 259-261 nachzulesen.
Verkehrsmäßig war Welzen, wie auch Schönenborn, an die Höhenstraße Obersteeg über Kalkofen nach Lindlar, jetzige Bezeichnung K 24, angebunden. Die Lennefetalstraße wurde erst um 1890 ausgebaut. Um 1894 wurde die Straße Hohkeppel - Schmitzhöhe mit einer Brücke über die Lennefe erbaut. Der Verbindungsweg zwischen Köttingen und der Schule Schmitzhöhe über Schönenborn war bis 1912 einspurig. Überholen war an dieser Strecke nur an Überholbuchten möglich. Deshalb mußten sich die Fuhrleute an unübersichtlichen Stellen durch Peitschenknallen bemerkbar machen. Der Schönenborner Weg führte vor dem Ausbau 1912 durch die Hoflage von Wilhelm Höller und hatte auf einer Strecke von etwa 50 m drei fast rechtwinklige Kurven. Über nur drei Seitenwege waren die jeweiligen Äcker zu erreichen.Die Nachbarorte wie Sieferhof, Schmitzhöhe-Ort und Kapelle sowie Luttersiefen und Holl, waren nur über Fußwege, genannt “Pettchen”, mit Schönenborn verbunden. In der Hoflage wurde der Weg 1912 begradigt verlegt, so dass Höllers eine geschlossene Hoffläche erhielten. Durch den Wegebau wurde ein uraltes Feuchtgebiet mit vielen Quellen -unterhalb des heutigen Brunnens - durch Aufschüttung um etwa einen Meter erhöht und ist heute kaum noch erkennbar. Auch der Vorplatz (früherer Weg) vor unserem Haus (Nr. 1) wurde stellenweise bis zu zwei Meter aufgefüllt. Erwähnt sei noch, dass bei dem damaligen Ausbau die Anlieger zur Verbreiterung bzw. Verlegung, das Gelände kostenlos hergaben. Auch Hand- und Spanndienste wurden kostenlos geleistet; selbst die Dampfwalze wurde von den Ortsbewohnern finanziert. Zum Abschluß veranstaltete man noch ein großes Fest. Man sieht, auch das Dorffest hat Tradition. Um 1954 wurde auch ein Verbindungsweg nach Schmitzhöhe ausgebaut. Es handelte sich in den Anfängen um eine sogenannte Milchstraße. Siefer von Schmitzhöhe fuhr einen Milchsammelwagen durch Schönenborn nach Köttingen, von wo aus der Spediteur Unterbusch diese dann nach Köln fuhr. Grundlage war der schon erwähnte Fußweg entlang der Grundstücksgrenze (Höller/Siefer). Dieser Weg hatte keinerlei Steingrundlage, doch fiel beim Ausbau des Stollens zur Wassergewinnung für die Wassergenossenschaft Schmitzhöhe ein guter Grauwakkestein an. Mit diesem wurden nun die ausgefahrenen Spuren wieder verfüllt und der Weg bekam eine Grundlage.
Unterhalb des heutigen Brunnens waren früher Weiheranlagen, die einem besonderen Ortsrecht unterlagen. Am 12.1.1797 wurde ein für alle Schönenborner gültiger Vergleich abgeschlossen. Demnach mußte der Weiher wieder vertieft werden, so dass die angrenzenden Wiesen wieder trocken wurden. Die ebenfalls dort vorhandenen Brunnen wurden gemeinschaftlich instandgehalten (siehe Festschrift “Der Widder” von 1976). Auch wurde das Bewässern der Wiesen (flötzen) für die Anlieger auf Tag und Stunde festgelegt. Jeder durfte an dem Weiher waschen und Vieh tränken. Unterzeichnet wurde dieser Vergleich von: Johann Roland Müller (Vorfahr der heutigen Familie Eschbach) und Johannes Schönenborn. Ferner unterzeichneten mit einem einfachen Kreuz: Wellem Gerhard Rappenhöner, Wellem Conrad Höller, Wilhelm Schmitz und Johannes Christian Müller. Als Scheffe unterschrieb ein gewisser Krahwinkel und Wilhelm Spiegel, Johann Gerhard und Johann Christian Funk als Zeugen.
Um 1870 hatten nur drei Wohnhäuser einen Schachtbrunnen mit Förderpumpe (Haus Nr. 1, Nr. 3/5 u. Nr. 6/8). Doch in Trockenjahren versiegten diese. Die Bewohner von zwei Wohnhäusern mußten das Wasser aus einem gemeinschaftlichen Brunnen unterhalb des Weihers holen. Man benutzte dazu einen Wasseresel, ein Stück Holz, in welchem die Schulterlage sowie der Hals ausgemeißelt waren. An den Enden waren Ketten befestigt, an die Wassereimer gehängt wurden.
1917 wurde hier eine gemeinschaftliche Widderanlage errichtet. Diese erwies sich in der Folgezeit als nicht ausreichend. Nicht nur durch zusätzliche Wohneinheiten, auch durch erhöhten Wasserverbrauch zu Milchkühlzwecken, trat öfter Wassermangel auf. Erwähnt sei auch der Zuzug von Wochenendlern und insbesondere die vielen Stadtflüchtliche bei Bombenangriffen auf die Städte, brachten Engpässe. 1957 erklärten sich die Schönenborner der Wassergenossenschaft Schmitzhöhe gegenüber bereit, ihr das, nach Errichtung einer geplanten Pumpenanlage zuviel geförderte Wasser zu überlassen. Weitere Verhandlungen führten zur Gründung eines gemeinsamen Genossenschaftsverbandes. Doch das Wasserwirtschafts- und Gesundheitsamt vereitelte die Absicht, den Brunnen in Schönenborn weiter zu nutzen.
Man beschloß den Ausbau eines Stollens der 14 m weit in den Berg getrieben wurde. Es erwies sich aber noch, dass innerhalb des Stollens noch zwei Brunnen sowie ein Nebenschacht mit Brunnen angelegt werden mußten. Über 260 cbm Wasser in 24 Stunden war das Ergebnis dieser Arbeit.
Dieser Erfolg hatte eine starke Bebauung hier im Ort zur Folge. 28 neue Häuser wurden in den letzten Jahrzehnten um den alten Ortskern herum gebaut. Auch zwei bis drei Kilometer im Umkreis setzte eine Bebauungsflut ein. Hier im Ort wurde neben dem Schönenborner Weg, der Kisselsgarten und eine weitere Seitenstraße des Schönenborner Weges mit Kanalanschluß und sämtlichen Versorgungsleitungen erschlossen. Bis Köttingen, Brombacher Berg, Strauch, Brombach, Welzen, Schmitzhöhe mit Kromsfeld und Luttersiefen und Holl, überall wütete der Bazillus “Bauland”.
Die sprunghafte Bebauung, welche schon Mitte der sechziger Jahre einsetzte, brachte auch einen starken Bevölkerungszuwachs. Zu der Zeit erwarb die Gemeindeverwaltung von Hohkeppel das notwendige Land für Sport- und Tennisplatz sowie Turnhalle. Die Schule wurde erweitert.
Bei der kommunalen Gebietsreform von 1975 wurde nicht nur der Gemeindeverband Hohkeppel gelöscht. Auch unseren Ortsnamen wollte man uns anfangs noch nehmen.
Man kann doch wohl noch mit Recht behaupten, dass wohl kein Ort im alten Gemeindeverband so viel für die Gesamtheit tat, wie gerade Schönenborn. Über die Hälfte ihres früheren Besitzes ging verloren, nicht nur für Bebauungszwecke, auch für bleibende, der Allgemeinheit dienende Zwecke. Erinnert sei an Sport- und Tennisplätze, Klärwerk, Sportplatz, Sporthalle und für schulische Zwecke. Auch die Grundstücke für die um 1850 erbaute Schule stammten aus Schönenborner Besitz. Auf einen kurzen Nenner gebracht: Schönenborn kann sich sehen lassen! Mögen alle, welche auf ehemaligem Schönenborner Grund gebaut haben, und jetzt Schmitzhöher sind - sei es in Kromsfeld, Auf den Rottem, im Hasenweg, in der Gartenstraße, Kutschweg, Waldwinkel, Reichenhain oder am Sebastianusweg - sich bewußt werden, dass sie nach vorgeschichtlichem Befund eigentlich zu Schönenborn gehören.
Vielleicht könnte dies ein Fingerzeig sein für die nächste Gebietsreform. Auch Sport- und Tennisplatz, wie Wasser- und Klärwerk gehören zu Schönenborn und nicht zu Köttingen.
Als 1976, nach Fertigstellung des Kanal- und Straßennetzes, das zukünftige Ortsbild feststand, wurde von den alten wie den neuen Schönenbornern gleichermaßen und unter der fachkundigen Leitung unseres Dorfsprechers Alois Eschbach mit der Gestaltung einiger Freiflächen begonnen. Im ersten Jahr (1976) stand der alte “Widder” aus dem Jahre 1917 im Mittelpunkt. Das im Herbst folgende Dorffest fand einen niemals geahnten Anklang von nah und fern. Vor allem wurden Brücken gebaut zu den zahlreichen Neubürgern im weiteren Umkreis. Gemeinde- und Kirchenvertreter brachten Glückwünsche und Anerkennung zum Ausdruck. Das gab Ansporn zu weiterem Ausbau. So wurde noch gegenüber der Widderanlage ein Grillplatz mit einer großzügig gestalteten Einfassung errichtet. Auch verschönten alle direkten Anlieger das Ortsbild durch Gestaltung ihrer Vorgärten. 1979 waren die neuen Email-Ortsschilder von Frau Leonore Rehbach der Mittelpunkt des Dorffestes. Im Jahre 1980 wurden eine notwendig gewordene Toilettenanlage sowie ein Abstellraum im Fachwerkstil erbaut und eingeweiht. Noch jedes Jahr steigerten sich Besuch und Anerkennung, so dass, darf man es behaupten, fast die ganze Gemeinde daran teilnimmt. Vor allem treffen sich die alten Schönenborner, welche auswärts seßhaft wurden, hier zu einem Gedankenaustausch. Aber auch immer wieder steigert sich die Einsatzbereitschaft der Ortsbewohner, das Dorffest weiter zu verschönern. dass es immer so bleiben möge, ist mein Wunsch.
Es war Wilhelm Eschbach der auf das Alter unseres Dorfes hinwies, worauf Alois Eschbach, der damalige "Dorfsprecher" gleich vorschlug, die Geschichtsträchtigkeit von Schönenborn beim nächsten Dorffest in den Vordergrund zu rücken. Nicht nur, dass Wilhelm Eschbach uns aufmerksam gemacht hätte, nein, er hat gleich die ganze Dorfgeschichte aufgearbeitet. Im Rahmen seiner Ahnenforschung, die ihn viele Jahre beschäftigte und bei der er zahlreiche alte Akten, insbesondere aus dem Nachlaß von Johann Breidenaßel studiert hat, entwickelte sich auch eine Vorstellung von der Entwicklung des Dorfes und von den verwandtschaftlichen Beziehungen und dem geschäftlichen Treiben der einzelnen Familien, die diese Entwicklung bestimmt haben. Seine Dorfchronik ist im wesentlichen ein Auszug aus den einzelnen Familienchroniken, die Wilhelm Eschbach von den alten Schönenborner Familien angefertigt hat und insofern auch nur eine Kurzfassung. Wenn es in der Chronik im Abschnitt “Wasserversorgung” heißt: “Im Scheurenbusch wurde ein erfolgversprechendes Wasservorkommen entdeckt”, dann muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass niemand anders als Wilhelm Eschbach dieses Vorkommen und später noch drei weitere, entdeckt hat. Als fachkundiger Wünschelrutengänger hat er an unzähligen Orten im Rheinland Wasservorkommen ausfindig gemacht. Wir danken ihm dafür, dass er uns die Geschichte unseres Dorfes ins Bewusstsein rückte und für die Nachwelt festhielt.
24. Mai 2025
Brunnenfest

7. September 2025
Dorffest

30. April 2025
Maifeier

Mai 2025
Maibaum Dorfplatz

jeden Monat
gemeinsames Backen

Copyright © 2025 Dorfgemeinschaft Schönenborn e.V.. Design: G.Czybulka
Haftung für Inhalte:
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Dienstanbieter sind wir für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Wir sind jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links:
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung für kommerzielle Zwecke bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.